Gesichter aus unserer Gemeinde
Thomas Heinke

Lieber Herr Heinke, unsere Kirchengemeinde in Kreuzberg-Mitte hat eine eigene Fußball-Mannschaft, und Sie sind ihr Trainer. Wie kommt es dazu?
Unser erstes Spiel gab es schon 1990. Ich war langjähriger Torhüter und bin der jetzige Trainer der „St. Jacobi Luisenstadt Fußball-Mannschaft“. Auf unseren Trikots steht „St. Jacobi“. Das alles ist entstanden aus der damaligen Jugendarbeit um Andreas Ehling, der heutige Gemeindeassistent der Kirchengemeinde. Er hat die Fußballmannschaft Anfang der 90er Jahre aufgebaut und unterstützt unsere Arbeit bis heute. Damals, als Andi Ehling – wir nannten ihn alle nur „Ehling“ - noch für die Jugendarbeit zuständig war, trafen wir uns immer sonntags im Waldeckpark in der Oranienstraße gegenüber der St. Jacobi-Kirche und spielten auf dem Rasen Fußball. Wir haben jeden Sonntag gebolzt. Irgendwann waren wir so viele Leute, dass die Kids und Jugendlichen zu Ehling kamen und fragten: Können wir nicht eine Fußballmannschaft gründen? Und seitdem gibt es die St. Jacobi-Fußball-Mannschaft.
Wie ging es dann weiter?
Zum Saisonstart 1991 meldeten wir uns zum ersten Mal für die Berliner Kirchenliga an (www.kirchenliga-fussball.de). Dort gab es eine erste Leistungsklasse und die Oberliga. Und mit dem ersten Spiel kam das „Wunder von Berlin“: Gleich in der ersten Saison 1991/92 wurden wir Pokalsieger und schlugen im Finale den mehrmaligen amtierenden Berliner und Deutschen Meister. Das war das Evangelische Johannesstift. Danach sind wir Kreuzberger konstant aufgestiegen und haben uns mehr oder weniger in der Oberliga etabliert. Das hat die großen Jungs natürlich geärgert.
Gibt es Anekdoten?
Die wollen Sie nicht hören... (lacht). Die schönste Anekdote ist, dass uns der liebe Gott im Finale gegen das Johannesstift Spandau geholfen hat. Das war das schönste Erlebnis. Aber dazu zunächst eine Vorgeschichte: Ich war damals 17 Jahre alt und Torhüter. Am Freitagabend vor unserem großen Spiel kam ich völlig nervös zu Ehling und fragte ihn: wie sollen wir das morgen schaffen, die knallen uns rein! Und Ehling antwortete: Bleib mal locker, die Spandauer kochen auch nur mit Wasser. Lass uns doch erst mal spielen und abwarten, und wenn jeder an sein Limit geht, können wir alles schaffen! Zum Johannesstift muss man außerdem folgendes sagen: Die Spandauer Mannschaft war eigentlich unantastbar. Die konnten wir nicht schlagen. Das ist, als würde eine Zweitligamannschaft gegen Bayern München gewinnen. Am nächsten Tag kam es zu der befürchteten Begegnung: Am Anfang, bis zur 12. Spielminute, stand es noch 0:0. Beim Johannesstift spielte einer, der hieß Mario Brand, wirklich ein sehr guter Spieler, spielte damals schon in der Oberliga. Der war eine Granate. Er zog aus 20 Metern ab. Ich stand für St. Jacobi im Tor, und ich dachte der Ball landet genau im Winkel, aber nein, ich hab mich mit meinem ganzen Gewicht und mit meinen 1,72 in die Ecke geworfen und holte das Ding aus dem Winkel, und damit stand es weiterhin 0:0. Im weiteren Spielverlauf gab es dann die Schlüsselszene, die zum Wunder von Berlin führte: Da war unser Spieler Peter Lorenz. Der läuft aufs gegnerische Tor zu, wird von einem Spandauer Spieler eingeholt und bedrängt. Der gegnerische Torwart kommt raus und verkürzt somit den Winkel zum Tor. Peter Lorenz schafft es zwar noch, den Ball aufs Tor zu schießen, aber nicht mehr mit voller Kraft, und der Ball rollt langsam in Richtung Torlinie, und dann - bin ich mir sicher, - gab es eine Windhose, und der Ball wurde von der Windhose über die Torlinie getragen, und der liebe Gott hat den Endstand von 4:1 erzielt! Für seine 14 schwarzen Schafe aus Kreuzberg!

Wie hat die Berliner Kirchenliga den Schnellstart von St. Jacobi verkraftet?
Es war damals nicht so einfach als Mannschaft aus Kreuzberg ohne jede Tradition. Wir brachen da mehr oder weniger in so eine festgefahrene Struktur mit dem Johannesstift als Bastion ein. Ich bin sonst kein Freund von Verschwörungstheorien, aber in den ersten Jahren war es so, dass der Berliner Meister und der Berliner Pokalsieger der Berliner Kirchenliga immer zur deutschen Meisterschaft gefahren sind, das nannte sich damals deutsche Eichenkreuzmeisterschaft. Das war die deutsche Meisterschaft aller Kirchenligen in der ganzen Bundesrepublik. Weil bei uns in Berlin die Leistungsdichte so hoch war, haben sie von uns immer zwei - den Berliner Meister und den Pokalsieger - geschickt. Aber ausgerechnet nach unserem Pokalsieg 1991 von St. Jacobi wurde die Regel geändert: Plötzlich wurde der Berliner Meister und der Vizemeister geschickt. Und nicht mehr der Pokalsieger. Und so blieb uns die Reise zur deutschen Eichenkreuzmeisterschaft verwehrt. Aber im Grunde genommen haben wir es geschafft, über Jahre hinweg die dritte Kraft zu werden hinter Don Bosco Berlin und Lichtenrade Nord. Die haben sich auf jeden Fall nicht gefreut, wenn sie gegen uns spielen mussten. Der Ehrlichkeit halber muss man sagen, wir waren auch nicht gerade für unser gutes Benehmen bekannt. Das kann man heute von uns nicht mehr sagen. Wir haben auch viele Fahrten zu Spielen gemacht, von Coesfeld über Stuttgart bis nach Dortmund. Das waren Kleinfeldturniere, aber wir hatten einen riesen Spaß dabei. Es ist witzig gewesen.
Was genau ist eigentlich die Berliner Kirchenliga?
Die Berliner Kirchenliga hat ein hohes Niveau. Es gibt bekannte Schiedsrichter, die ihre Wurzeln in der Berliner Kirchenliga haben. Zum Beispiel Robert Hoyzer, der durch den Bestechungsskandal in der Bundesliga aufgeflogen ist. Oder Manuel Gräfe, der in der Bundesliga Schiedsrichter ist, der hat auch früher bei Don Bosco in der Kirchenliga gespielt.
Übrigens: Um in der Berliner Kirchenliga mitspielen zu können, muss man nicht zwingend kirchlich sein, aber die meisten Mannschaften sind an eine Kirchengemeinde angeschlossen, zum Beispiel die Mannschaften St. Nikolai Spandau, Lukas Schöneberg, oder die Sportsfreunde Ökumene. In der Kirchenliga spielt aber auch der Ditib Sportclub Berlin, FC Bosporus Berlin oder Teba Moschee Spandau. Im Sport spielt Herkunft und Religion keine Rolle, jedenfalls keine trennende.
Wer waren denn die anderen Spieler in der damaligen Mannschaft?
Ich war etwa 16 oder 17 Jahre alt. Wir wohnten alle in Kreuzberg, im Kiez um die Otto Suhr Siedlung, in der Ritterstraße, Lobeckstraße. Damals war die berühmte St. Jacobi Jugend-Disco gerade aus dem Keller unter der Küsterei in den Seitenflügel umgezogen. Wir kannten uns auch alle aus der Konfirmandenarbeit mit den Pfarrern Haucke und Storck, und natürlich unseren Andi Ehling. Das war damals super hier, wir haben eigentlich fünf Mal die Woche Trainingstreffen gehabt. Jeden Freitag gingen wir in die Disco, und samstags spielten wir Fußball. Am Anfang waren wir 24 Leute. Wir spielten zehn gegen zehn mit vier Auswechselspielern. Ehling war zu 98 Prozent Trainer, Aufpasser, Ordner, Kartenabreißer - bis seine beiden Knie kaputt waren. Und Pfarrer Hauke hat mich später getraut.
Und warum hat die St. Jacobi Fußballmannschaft Pause gemacht?
Wir spielten 15 Jahre lang, bis 2006. Von 2007 bis 2017 gab es eine Pause von zehn Jahren, und seit 2017 stehen wir wieder auf dem Platz. Wir hatten keinen Nachwuchs mehr. Jugendarbeit hatte keine mehr stattgefunden, jedenfalls nicht mehr in dem Maß wie vormals. Wir waren ins Alter gekommen, hatten Familien gegründet, es gab viel Wegzug.

Und wie kam es zu dem Revival?
Das war meine Idee. Ich habe die A-Jugend in Tempelhof trainiert, bis die sich aufgelöst hat. Viele Spieler wussten nicht mehr, was sie machen sollten. Dann hatte ich die Idee, die St. Jacobi Mannschaft wiederzubeleben. 2016 hat das Jubiläumsturnier der Berliner Kirchenliga stattgefunden. Dazu wurden wir eingeladen, obwohl wir in Vergessenheit geraten waren, das war toll. Und da sind wir zweiter geworden. Wir alten Säcke. Im Sommer, wenn es länger hell ist, treffen wir uns sonntags und spielen dort, wo Vereinsspiele zu Ende sind, in Mariendorf zum Beispiel. Im Winter trainieren wir in der Soccerworld Berlin. Das kostet 90 Euro für 90 Minuten, das teilen wir dann untereinander auf.
Und wer spielt heute für St. Jacobi?
Wir sind derzeit etwa 20 aktive Spieler. Manche sind ehemalige Spieler aus den Mannschaften der Kirchengemeinden von Judas-Thaddäus und aus der Herz-Jesu-Gemeinde. Wir haben übrigens ganz verschiedene Kulturen in unserer Mannschaft. Wir haben Muslime und Christen, evangelische und katholische, und wir haben einen kolumbianischen Juden bei uns. Aber auch damals in den 90ern waren wir schon eine multikulturelle Truppe, typisch Kreuzberg eben. Natürlich würden wir uns über neue Mitspieler freuen! Für den Saison-Beginn melden wir zunächst mal alles an, was laufen kann. Natürlich gibt es auch gute Fußballer in unseren Reihen, aber das muss sich alles erst noch finden. Die Spiele sind immer samstagsmorgens, zwischen zehn und zwölf.
Und wie geht es jetzt weiter?
Wir haben uns jetzt Trainingsanzüge bestellt. Auch den ersten Satz Trikots haben wir selber gekauft. Auch das Startgeld und die Versicherung müssen gezahlt werden. Das hat über lange Jahre die Gemeinde getragen. Jetzt sind wir sehr froh und dankbar, dass die Gemeinde uns ab dieser Saison wieder unterstützt. Wir würden uns aber auch freuen, wenn die Gemeinde in Kreuzberg-Mitte uns auch ideell weiter unterstützt. Unsere nächsten Spiele 2018 sind am 3. März gegen JC Sonnetreff Mariendorf, am 10. März gegen den DITIB Sportclub Berlin, am 17. März gegen Buckow United Neukölln und am 24. März gegen Fortuna Reinickendorf 65. Die Spielstätten werden noch bekannt gegeben. Wir brauchen außerdem noch gute Fotos für Facebook. Dort gibt es uns als Fußball-Mannschaft nämlich auch, unter dem Namen: St. Jacobi Luisenstadt.
Wie ist das für Sie, heute Trainier zu sein?
Ich mache das alles ehrenamtlich. Hauptberuflich bin ich selbständig. Ich arbeite als Kurier und fahre Kleintransporte. Die Jungs heute sind anders als damals. Das ist heute eine ruhigere und sensiblere Spieler-Generation. Das Problem ist die Unzuverlässigkeit der Jugendlichen. Wenn die es jeden Samstag zum Training schaffen, dann ist das schon eine Leistung. Ein weiteres Problem ist es, einen Trainings-Ort zu finden: Trainieren ist heutzutage gar nicht so einfach, weil es in Berlin wenig bespielbare Plätze gibt. Uns würde ja ein halber Platz reichen.
Was sind Ihre Ziele für 2018?
Für die erste Saison haben wir uns noch keine anderen Ziele gesetzt, als einfach nur durchhalten. 2017 sind wir mit der Hinrunde eingestiegen und wurden Zehnter, das ist so im Mittelfeld. Aber das ist ja erst der Anfang. Die Rückrunde wird wesentlich besser werden, da bin ich mir sicher!
Ich wünsche Ihnen und unserer Fußball-Mannschaft St. Jacobi viel Erfolg bei den weiteren Spielen und danke für das Gespräch!
Das Interview mit Thomas Heinke und Andreas Ehling führte Pfarrer Christoph Heil.
Anna van Bürck

Liebe Anna, du machst gerade ein Praktikum in unserer Gemeinde im Bereich Gemeindepädagogik. Was erlebst du da?
Ich habe erstmal die verschiedenen Aufgabengebiete des Berufsfelds Gemeindepädagogik kennengelernt. Diese Bereiche umfassen die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde sowie die Arbeit im Kirchenkreis Berlin Stadtmitte. Ich habe schon mehrere Kindergottesdienste mit Konrad Opitz und dem Team unserer Gemeinde vorbereitet und durchgeführt. Darüber hinaus konnte ich auch schon erste Erfahrungen in unserer Nachbargemeinde „Jesus Christus“ bei den Kindersamstagen sammeln. In der Jugendarbeit erlebe ich wöchentlich den Konfirmationsunterricht und die Treffen in unserem Jugendturm. Für die Jugendlichen unserer Gemeinde bieten wir eine Ausbildung zum Jugendleiter an, wo sie ein entsprechendes Zertifikat erwerben können (die sog. Jugendleiterkarte). Bei dieser Ausbildung bin ich mitverantwortlich und unterstütze das Ausbilderteam.
Das ist eine ganze Menge...
...außerdem erfahre ich in meinem Praktikum auch, welche Aufgaben die Gemeindepädagogen unter der Woche so alles durchführen müssen. Dazu gehören organisatorische Aufgaben sowie die Mithilfe in der Küsterei. Aufgaben, die Außenstehende gar nicht so mitbekommen. Weitere Aufgaben in meinem Praktikum betreffen die konkrete Gemeindearbeit. Ich nehme an Dienstbesprechungen, Gesprächen mit den Pfarrern sowie mit anderen Gemeindemitarbeitern teil. Ich habe mich auch schon mit anderen Gemeindepädagogen im Rahmen meines Praktikums getroffen.
Besonders interessant für mich sind die Planungsarbeiten im Kirchenkreis für die anstehende Konfirmandenfreizeit im Sommer. Hier bekommt man erstmal einen Einblick, was alles bedacht werden muss.

Was macht dir am meisten Spaß in der Arbeit?
Zwei Aufgabenbereiche machen mir besonders große Freude: Das ist die Arbeit mit den Kleinen im Kindergottesdienst und mit den Großen im Konfirmandenunterricht. Daher überlege ich, zum kommenden Wintersemester ein Studium an der Evangelischen Hochschule in Berlin zu beginnen. Ich wollte gerne mal das „ganze“ Gemeindeleben als Praktikantin miterleben. Viele Bereiche, die Gemeindepädagogen abdecken, kenne ich zwar auch schon aus meiner langjährigen ehrenamtlichen Arbeit, aber viele Bereiche sind ganz neu für mich.
Wie bist du auf unsere Gemeinde aufmerksam geworden?
Unsere Frau Hünerbein ist „schuld“! Bei ihr habe ich mit sechs Jahren das Flötespielen begonnen. Es folgten etliche Kinderfreizeiten der Gemeinde nach Hirschluch und im Jahre 2010 startete ich dann mit dem Konfi-Unterricht bei Pfarrer Holger Schmidt. Auch nach der Konfirmation blieb ich der Gemeinde treu und war regelmäßig bei den Jugendtreffs bei Lea Baumann (jetzt Lea Garbers). Es folgten die Teilnahmen an den jährlichen Jugendfreizeiten, und nach meinem Abitur bin ich dann sogar als Betreuerin mitgefahren. Darüber hinaus bin ich seit 2011 als ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Gemeinde in den Bereichen Kindergottesdienst, Kindersamstage, Kinderfreizeiten, Jugendturm sowie bei den obengenannten Jugendfreizeiten tätig.
Dein Nachname ist van Bürck – hast du niederländische Wurzeln?
Leider weiß ich das nicht genau. Zwar hat mein Großonkel versucht, die Herkunft des Namens zu recherieren, aber seine Forschungsergebnisse reichen nur bis zum Jahr 1648 zurück. Viele „van Bürcks“ lebten zu dieser Zeit in Nordrhein-Westfalen.
Wer oder was würdest du gerne mal an Fasching sein?
Ich verkleide mich ehrlich gesagt nicht so gerne, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich entweder als Queen oder als Kronprinzessin gehen.
Peter Eichbaum
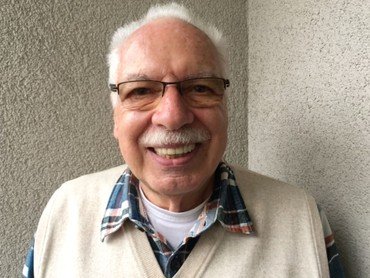
Lieber Herr Eichbaum, sind Sie glücklich?
Ich bin seit 50 Jahren mit meiner Frau Barbara verheiratet. Ein größeres Glück könnte ich mir nicht vorstellen. Gemeinsam wohnen wir seit ebenfalls 50 Jahren in unserer Wohnung in der Neuenburger Straße in Kreuzberg. Wir haben eine Tochter und drei Enkelkinder. Ja, ich bin glücklich!
Wie war das damals, vor 50 Jahren?
Damals durfte man nur gemeinsam eine Mietwohnung beziehen, wenn man verheiratet war. Als wir verlobt waren, wohnten wir noch beide bei unseren Eltern. Zuerst musste man beim Standesamt ein Aufgebot machen, das heißt, man musste formell anmelden, dass man vorhat, zu heiraten. Dann gab es einen öffentlichen Aushang, und jeder konnte Einspruch erheben. Das hat bei uns niemand getan, und so haben wir am 27. Januar 1967 geheiratet, und am 1. Februar 1967 sind wir zusammengezogen.
Und danach haben Sie es krachen lassen?
Danach sind wir zu unserer Hochzeitsreise aufgebrochen. Wir wussten nur eins: Wir wollten unbedingt Urlaub im Schnee. Wohin, wussten wir nicht genau. So sind wir auf gut-Glück losgefahren, mit Schneeketten am Auto. An der Marblinger Höhe bei Kufstein in Österreich, kurz hinter der deutsch-österreichischen Grenze, sind wir angekommen. Wir waren beide noch nie Skifahren und haben auch bis heute nie auf Skiern gestanden, aber wir hatten Skistiefel dabei und sind damit viel im Schnee gewandert. Es war herrlich!
Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt?
In der Straßenbahn. Wir wohnten beide bei unseren Eltern in Kreuzberg und arbeiteten beide beim Bezirksamt Kreuzberg, kannten uns auch vom Sehen. Eines Morgens sahen wir uns in der gleichen Straßenbahn. Aber wir standen jeder in einem anderen Wagen – ich im einen, meine Frau, Barbara, im anderen. Wir sahen uns nur durch die Scheiben. Als wir ausgestiegen waren, kamen wir ins Gespräch. Unsere erste Verabredung hatten wir in der Deutschlandhalle an der Messe. Dort sahen wir die Operette „Blume von Hawaii“ von Paul Abraham. Am 4. September 1964 verlobten wir uns.
Woran denken Sie besonders gerne zurück?
Da fallen mir die vielen schönen Reisen nach Amerika ein. 1971 wurde unsere Tochter geboren, und seit 1973 flogen wir alle zwei Jahre einmal für mindestens einen Monat über den Atlantik. In USA haben wir uns immer einen Mietwagen genommen und sind alle Bundestaaten abgefahren, bis auf Alaska und Hawaii. Unsere erste Reise ging schon 1987 entlang der Ostküste runter bis Key West, Florida. Später fuhren wir die Ostküste rauf bis nach Neu-England. Ich habe meine Frau und Tochter ganz schön rumgescheucht. Am meisten beeindruckten uns die wunderschöne Natur und die Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Offenheit der Amerikaner. Wenn wir mit der Karte nach dem Weg suchten, blieben die Menschen stehen und fragten uns, wie sie uns helfen könnten. Als sie hörten, dass wir aus Deutschland kamen, freuten sie sich riesig und erzählten, dass sie deutsche Vorfahren hatten oder in Deutschland studierten. Heute zehren wir von diesen Erinnerungen.
Reisen war ja etwas Besonderes, wenn man in Westberlin groß geworden ist und in der Nähe der Mauer wohnte...
...natürlich, wenn wir Kurzreisen in den Harz oder an die Nordsee machten, mussten wir immer die innerdeutsche Grenze passieren: An der Stadtgrenze Berlins aussteigen, in die Grenz-Baracke gehen, Formulare ausfüllen, an die Kasse gehen, dazwischen immer lange Wartezeiten. Dann kam die Kontrolle des Wagens, das war ja ein riesiger Aufwand. Und wenn man nach der Durchreise an der innerdeutschen Grenze angekommen war, ging die ganze Prozedur von vorne los. Heute fährt man frei durch Deutschland und Berlin als wäre nie etwas gewesen. Aber an die Angst können wir uns gut erinnern.
Wie sind Sie damals damit umgegangen?
Wir haben uns damit arrangieren müssen. Als wir von unserer Hochzeitsreise zurück an die DDR-Grenze kamen, zog der DDR-Grenzer unsere Fotos von den Flitterwochen aus dem Handschuhfach und schaute sie sich ganz genau an. Das war ein Eingriff in die Privatsphäre. Dann durfte man nichts sagen, nicht mal lachen oder gar lächeln, man war ja völlig abhängig in dem Moment. Einmal erlebten wir eine seltene Ausnahme, das war am Grenzübergang in Helmststedt. Wir waren zu dritt im Auto: Meine Frau und ich, und unsere Tochter auf dem Rücksitz. Neben ihr saß ihr großer Stoff-Schlumpf. Als der Beamte sich die Papiere ansah, sagte er, er könne uns nicht durchlassen. In den Papieren stünden drei Personen. Im Auto säßen aber vier. Ja, für den Schlumpf unserer Tochter hatten wir natürlich keine Durchreiseerlaubnis beantragt, aber der humorvolle Grenzer hat uns dann doch unsere Reise fortsetzen lassen. Nach der Ost-West-Annäherung war es ein bisschen leichter, aber wir haben uns vor diesen Fahrten immer ein bisschen gefürchtet.
Was verbindet Sie eigentlich mit unserer Kirchengemeinde in Kreuzberg?
Ich bin Kreuzberger. Ich wurde 1939 in der Forster Straße in Kreuzberg geboren. Dort bin ich auch aufgewachsen. Ich wurde evangelisch getauft und konfirmiert. Ab 2002 war ich Mitglied bei der Stiftung Historische Friedhöfe. 2003 wurde ich als Ersatzältester in den Gemeindekirchenrat von St. Jacobi gewählt, und ab 2004 war ich ordentliches Mitglied und beschäftigte mich vor allem mit den Finanzen und Haushaltsfragen. Ich habe alle Rechnungen überprüft. Ich war ja beruflich in der Verwaltung tätig. Zuerst seit 1955 im Bezirksamt Kreuzberg in der Yorckstraße, dann ab 1972 bei der Pädagogischen Hochschule und später bei der Hochschule der Künste, die heutige Universität der Künste.
Sie haben ja Ihre Goldene Hochzeit in St. Jacobi-Kirche gefeiert. Wie war das für Sie beide?
Ich bin evangelisch, meine Frau ist katholisch. Wir wollten von Anfang an eine Gleichberechtigung der Konfessionen in unserer Familie: Daher hatten wir vor 50 Jahren vor, katholisch zu heiraten und unsere Kinder evangelisch zu erziehen. Aber das war damals alles noch nicht so einfach. Der katholische Pfarrer bestand darauf, dass wir unsere Kinder auch katholisch erziehen. So haben wir uns für die evangelische Trauung entschieden. Und unsere Tochter wurde katholisch getauft. Unsere Silberne Hochzeit haben wir dann in der St. Agnes-Kirche in der Alexandrinenstraße ökumenisch feiern können. Unsere Goldene Hochzeit feierten wir dieses in der St. Jacobi-Kirche. Unsere Tochter, die mit ihrem Ehemann und unseren drei Enkelkindern heute in Österreich lebt, war da und hat gesungen. Unser Enkel hat auf der Orgel „Sound of Silence“ und den Pachelbel-Kanon gespielt. Unsere Tochter und unsere drei Enkelkinder sind unser ganzer Stolz.
Herzlichen Glückwunsch! Und Ihr Hochzeitsvers?
Unser Hochzeitsvers steht in Psalm 39, Vers 8: „Wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich.“ Dieser Vers hat uns in vielen schweren Situationen begleitet. Wir haben erfahren, dass Gott uns in unserem Leben und in unseren 50 Jahren Ehe begleitet hat. Das gilt auch für die schwierigen Zeiten: 2010 wurde bei mir eine Augenkrankheit diagnostiziert, die mir das Lesen zunehmend erschwert. Das beschäftigt mich sehr, denn ich habe vier Hobbies, für die ich vor allem meine Augen brauche: Modellbahn, Briefmarken, Fotografie und Lesen. Ich habe über 20.000 Dias von unseren Urlaubsreisen gesammelt, aber auch Dias von Bauwerken in Berlin. Dazu brauche ich meine Augen.
Was uns außerdem belastet ist die seit einem Jahr anhaltenden Renovierungsarbeiten unseres Hauses durch die Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen. 2004 bekamen wir neue Kunststofffenster. Die wurden nun wieder entfernt, weil sie nicht mehr den Standards entsprechen. Jetzt bekommen wir wieder Holzfenster. Nächstes Jahr folgt die Wärmedämmung. Das Bad ist kleiner geworden. Es gibt viele Einschränkungen und unklare Zuständigkeiten. Man rennt den Handwerkern hinterher. Manchmal kann man sich gar nicht verständigen. Für die Modernisierung droht uns jetzt ein Mietaufschlag von 265 Euro.
Lieber Herr Eichbaum, vielen Dank für das Gespräch!
Die Fragen stellte Pfarrer Christoph Heil
Martina Hübener

Liebe Frau Hübener, fühlen Sie sich als Kreuzbergerin?
Ja, ich fühle mich als Kreuzbergerin und lebe hier sehr gern. Ich wohne seit 1981 in Kreuzberg, zuerst in der Dieffenbachstraße und seit 2000 am Carl-Herz-Ufer. Hier ist mir alles sehr vertraut: die Admiralbrücke, der Böckler-Park, das belebte Ufer am Urbanhafen, der Südstern. Dieses und noch viel mehr ist für mich ein ganz besonderes Lebensgefühl. Von unserer Wohnung habe ich einen sehr schönen Blick auf den Landwehrkanal, auf die Kirchtürme von Melanchthon und St. Simeon und auf den Fernsehturm. Hier soll ja die „Toskana Kreuzbergs“ sein.
Haben Sie ein Lieblings-Kirchenlied?
„Er weckt mich alle Morgen“. Im Internet habe ich hierzu den Tagebucheintrag des Dichters Jochen Klepper gefunden vom 12. April (Geburtstag meines Sohnes) 1938, der mir so gut gefallen hat: „Weicher, glänzender Tag. Meine kleinen Osterbesorgungen für Mutter, Frau und Töchter. In unserem alten Garten in der Seestraße blühen die alten Kirschbäume so schön. […] Ich schrieb heute ein Morgenlied über Jesaja 50, 4.5.6.7.8, die Worte, die mir den ganzen Tag nicht aus dem Ohr gegangen waren.“ Als Abendlied finde ich „Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen“ so schön. Da steht eigentlich alles drin, vor allem die fünfte Strophe: „So sei es, Herr: die Reiche fallen, dein Thron allein wird nicht zerstört; dein Reich besteht und wächst, bis allen dein großer, neuer Tag gehört.“ Auch die Irischen Segenslieder zum Beispiel „Möge die Straße uns zusammenführen“ gefallen mir besonders gut.
Was verbindet Sie mit der Kirchengemeinde in Kreuzberg-Mitte?
Sehr viel. Ich bin an einem Sonntag im Mai 1995 zum ersten Mal in der Melanchthon-Kirche in den Gottesdienst gegangen. Die Liturgie und vor allem die Orgel haben mir besonders gut gefallen. Mein Sohn ist 1999 in Melanchthon von Pfarrer Christian Zeiske getauft und von Pfarrer Holger Schmidt 2014 in St. Jacobi konfirmiert worden. Mein Mann und ich haben uns letztes Jahr in St. Jacobi kirchlich trauen lassen und hatten eine schöne Hochzeitsfeier im Jacobi-Garten. In St. Simeon habe ich die Entstehung der Flüchtlingskirche miterlebt, den Eröffnungsgottesdienst und den im Fernsehen übertragenen Eröffnungsgottesdienst. Ich finde es gut, dass es die Flüchtlingskirche hier in Kreuzberg gibt mit ihren Beratungsangeboten für Geflüchtete und den verschiedenen Möglichkeiten, mit denen man sich selbst mit den Themen Flucht, Asyl und Menschenrechten auseinandersetzen kann. An der Vorbereitung und Durchführung der ersten Weihnachtsfeier im Jahr 2015 habe ich gern teilgenommen. Es waren auch viele Geflüchtete, die damals in der Turnhalle in der Geibelstraße untergebracht waren, mit dabei.
Was verbinden Sie mit dem Monat November?
Mit dem Gedenkmonat November verbinden mich zuerst natürlich der Fall der Berliner Mauer, aber auch die Novemberpogrome. Ich finde es immer wieder bedrückend, dass die Ereignisse damals für so viele Menschen nicht nur gleichgültig waren, sondern auch so viel Zustimmung fanden.
Ich frage mich, wie das für meinen Großvater Martin Hübener, damals Pastor im heutigen Mecklenburg-Vorpommern und Mitglied der Bekennenden Kirche, gewesen sein muss. In der Gemeinde Eldena hat er auch unter großen Anfeindungen immer wieder über das Unrecht, das den Juden widerfuhr, gepredigt. Als er am Israelsonntag, dem 10. Sonntag nach Trinitatis, der das Verhältnis von Christen und Juden zum Thema hat, 1935 eine als „freiwillige Spende“ deklarierte Sammlung für christlich-jüdische Projekte durchführte, wurde er von SA-Leuten und örtlichen Deutschen Christen misshandelt und niedergeschlagen und zum ersten Mal verhaftet. Nach einer weiteren Festnahme, unter anderem ebenfalls für „Unerlaubtes Kollektieren“ am Israelsonntag 1937, wurde er erst nach fünf Monaten Haft wieder entlassen.
Meine Großeltern lebten später in Sanitz bei Rostock und durften uns im Ruhestand regelmäßig einmal im Jahr in Bielefeld, wo ich aufgewachsen bin, für vier Wochen besuchen. Mein Großvater ist mir auch deswegen in besonderer Erinnerung, da er mir oft von Dietrich Bonhoeffer erzählt hat. Er hat ihn als einen sehr mutigen Pfarrer gewürdigt, der für seine aufrechte Haltung sein Leben verloren hat.
Die Gedenkveranstaltungen finde ich sehr wichtig, auch im Hinblick auf die Fremdenfeindlichkeit und den Antisemitismus, der insbesondere auch wieder mit dem rechtsextremen Terror der Zwickauer Zelle deutlich wird.

Seit einiger Zeit kümmern Sie sich um den St. Jacobi-Garten. Was bedeutet Ihnen Gartenarbeit?
Gartenarbeit bedeutet für mich, etwas unter freiem Himmel im Einklang mit der Natur zu tun. Ich bin dankbar, dass ich hierzu in St. Jacobi die Möglichkeit habe. Einen Garten kann man verwildern lassen, was für die Natur auch gut ist. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel eine Blumenwiese anzulegen, in der sich die Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Igel wohlfühlen. Man kann aber auch versuchen, die vorhandenen Beete so zu pflegen und zu gestalten, dass viele verschiedene Blumen das ganze Jahr zur Freude Aller blühen.
Dazu ist es mitunter erforderlich, Unkraut zu entfernen, wenn es überhandnimmt, und dann an dieser Stelle etwas Neues zu pflanzen, damit wieder etwas Schönes entsteht, das blühen und sich ausbreiten kann. Das verbinde ich mit Gartenarbeit, wobei mir hier eher der Begriff Inspiration in den Sinn kommt. Auch das Rauschen der Bäume im Kirchgarten hat diese Wirkung auf mich.
Mir bedeutet es auch sehr viel, den Verlauf der Jahreszeiten in der Natur mitzuerleben und dass hierzu für mich die Gelegenheit mitten in Berlin besteht, finde ich hervorragend. Zurzeit erlebe ich dieses alles überwiegend allein, wobei ich aber auch nicht ganz allein bin: die Eichhörnchen verfolgen oft sehr genau, was sich dort tut.
Da ich in der Regel auch nicht mehr als zweimal im Monat samstagvormittags kommen kann und die Zeit immer sehr schnell vergeht, würde ich mich sehr freuen, wenn sich die eine oder der andere angesprochen fühlt, vielleicht einmal dazuzukommen und sich auch inspirieren zu lassen.
Letzte Woche haben wir schon gemeinsam zu dritt in einem Baumarkt nach einer sehr freundlichen und fachkundigen Beratung ein paar Bodendecker und eine Christrose für den Garten im Kolonadenhof gekauft und anschließend einen kleinen Abstecher zum Schloss Britz und zu der dortigen kleinen Kirche gemacht. Das Einpflanzen ging dann nach der Rückkehr mit Freude und flott von der Hand. Hier bin ich gespannt, wie sich die Blumenzwiebeln für den Hyazinthen-Mix und die Schneeglöckchen entwickeln, und was im Frühjahr daraus wird.
Als nächstes steht die Planung und Gestaltung im Kirchgarten an, wo im kommenden Sommer ein schönes Staudenbeet blühen soll.
Liebe Frau Hübener, vielen Dank für das Gespräch!
Die Fragen stellte Pfarrer Christoph Heil
Konrad Opitz

Sie sind seit dem 1.10.2017 als Gemeindepädagoge in unserer Gemeinde angestellt. Mit welchen Erwartungen kommen Sie nach Kreuzberg-Mitte?
Ich bin sehr gespannt auf die verschiedenen Menschen, mit denen ich in meiner Arbeit zu tun haben werde, und freue mich auf eine vielfältige Tätigkeit. Ich freue mich darauf, bewährte Angebote in der Jugendarbeit und der Arbeit mit Kindern fortzuführen, aber auch neue Ideen einzubringen. So würde ich z. B. gerne ein kleines theaterpädagogisches Projekt durchführen.
Was hat Sie bewogen, Gemeindepädagoge zu werden?
Mit etwa 16 Jahren bin ich in die junge Gemeinde in meiner Heimatstadt Eberswalde gegangen und habe dort Menschen aus unterschiedlichen Milieus kennengelernt. Wir waren alle sehr verschieden, und es hat mich schon damals fasziniert, wie gut wir uns gegenseitig bereichert haben – sei es nun bei der Planung von Jugendgottesdiensten oder bei erlebnispädagogischen Aktivitäten wie mehrtägigen Kanu- und Wandertouren. Ich habe mit 21 Jahren gewusst, dass ich Gemeindepädagoge werden möchte, weil dieser Beruf mir ermöglicht, mich entsprechend meinen Fähigkeiten für andere Menschen einzusetzen und ihnen eine Beheimatung in der Gemeinde anzubieten. Das geht nur, wenn Menschen sich angenommen und verstanden fühlen. Ein Bild, das mich schon seit meiner Jugendzeit begleitet hat, ist die Vorstellung der Gemeinde, dass sie ein Leib mit vielen Gliedern ist und jeder Teil dieses Leibes unterschiedliche Funktionen hat, um die Gemeinschaft in Christi aufzubauen und zu stabilisieren.
Sie sind Mitglied in einem Mittelalterverein. Um was genau geht es da?
Kurzgefasst: um die historisch korrekte Darstellung des Söldner- und Lagerlebens in der Zeit des ausgehenden Mittelalters im historischen Zeitabschnitt von 1410 bis 1450 n. Chr. Wir stellen deutsche Landsknechte dar, wie sie in der Schlacht bei Tannenberg (in Grunwald, Polen) um 1410 vom Deutschen Orden angeworben wurden um das Ordensland gegen ein Militärbündnis zwischen dem Königreich Polen und dem Großherzogtum Litauen zu verteidigen.

Was sind das für Aktivitäten?
Als historischer Mittelalterverein werden wir in den Sommerhalbjahren von verschiedenen Veranstaltern von Mittelalterfesten engagiert um historische Schaukämpfe vorzuführen und mittelalterliches Lagerleben darzustellen. Dabei sind wir oft deutschlandweit unterwegs – aber auch in Polen, Holland oder Frankreich.
Wie schwer ist so eine Ritterrüstung, und wie kommt man da rein und raus? Kämpft man mit echten Waffen?
Eine Vollrüstung wiegt zwischen 30 und 50 kg, das ist typenabhängig. Wir tragen in unserem Verein Brigantinen (Lederrüstungen, d. Red.), Plattenpanzer und Visierhelme aus Eisen. Ohne fremde Hilfe kommt man da nicht alleine rein. Lediglich das Kettenhemd kann man sich ohne fremde Hilfe anziehen. Unsere Schaukampfwaffen sind zwar stumpf, aber aus Metall und entsprechenden Waffentypen, wie sie in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts gebräuchlich waren. Dazu zählen Streitäxte, Schwerter, Schilde, Hakenbüchsen - natürlich nur mit Platzpatronen - und diverse Langwaffen. Pferde gibt es bei uns nicht. Landsknechte kämpften stets zu Fuß und wurden von den Fürsten oft gezielt gegen Reiter eingesetzt, da sie hervorragende Speerkämpfer waren, die effektiv gegen Reiter kämpfen konnten.
Sie haben Ihre Abschlussarbeit über alternative, zukunftsfähige Konzepte in der Konfirmandenarbeit geschrieben. Wenn Sie kurz zusammenfassen: worum ging es?
Ich habe verschiedene, bestehende Konzepte der Konfirmandenarbeit aus den evangelischen Landeskirchen in Deutschland, nach verschiedenen Inhaltsapekten wie Lebensweltbezug biblischer Themen zur Lebenswirklichkeit Jugendlicher und Gegenwartsbezug untersucht und aus religions- und entwicklungspsychologischer sowie soziologischer Perspektive in Hinblick auf Kinder- und Jugendliche begutachtet. Ziel der Arbeit war es, eine Empfehlung zu geben, wie bestehende gegenwärtige Konzepte der Konfirmandenarbeit optimiert werden können um Jugendliche in der jeweiligen Kirchengemeinde zumindest vorübergehend besser zu beheimaten.
Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
Letztendlich kam ich zu dem Ergebnis, dass sogenannte zweiphasige Modelle der Konfirmandenarbeit (Hoyaer Modell, Bremer Modell) besonders für Jugendliche geeignet sind. In der zweiphasigen Konfirmandenarbeit wird die Konfirmandenzeit in Vorkonfirmandenzeit und Hauptkonfirmandenzeit aufgeteilt. Die Vorkonfirmandenzeit findet in der 3. oder 4. Klasse statt, wenn die Kinder 9 bis 10 Jahre alt sind. Abgeschlossen wird die Vorkonfirmandenzeit mit einem besonderen Familiengottesdienst. Die Hauptkonfirmandenzeit findet in der 8. Klasse statt, wenn die Jugendlichen 14 Jahre alt sind und wird mit der traditionellen Konfirmation abgeschlossen. Ich habe festgestellt, dass bei erfolgreicher Umsetzung eines zweiphasigen Modells tendenziell mehr Jugendliche in der Gemeinde erreicht und beheimatet werden könnten, als mit dem klassischen, wöchentlichen Konfirmandenunterricht in anderthalb bis zwei Schuljahren während der 7. und 8. Klasse. Zweiphasige Modelle ermöglichen, dass die Kinder und Jugendlichen mit Kopf, Herz und Verstand Themeninhalte vermittelt bekommen - orientiert an ihrem entsprechenden psychologischen Entwicklungsstand und gezielt kombiniert mit erlebnispädagogischen und gruppenbildenden Lernangeboten.
Sie sind in einem Forsthaus in Eberswalde aufgewachsen. Vermissen Sie die Natur?
Ich bin ein sehr großer Naturfreund und suche in meiner Freizeit gerne und oft die Natur auf und bin froh, dass selbst die Großstadt Berlin so viele grüne Ecken zu bieten hat. Ich gehöre ja noch zu der Generation, die während ihrer Kindheit mit der Natur aufgewachsen ist und mehr Spaß daran hatte, in Wäldern und Wiesen zu spielen als in virtuellen Welten vor dem Computer oder dem Smartphone zu versumpfen. So ist es mir auch in meiner gemeindepädagogischen Arbeit wichtig, mit digitalen Massenmedien, aufgewachsenen Kindern und Jugendlichen die Wunder der Schöpfung in der Natur nahe zu bringen und ihnen zu vermitteln, dass die Natur mit Respekt, Demut und Dankbarkeit behandelt werden sollte. Die Anweisungen Gottes, dass der Mensch die Erde bebauen und bewahren sind für mich ein Teil und Ziel meiner Lebenseinstellung.
Christine Freudenberg

Christine, herzlich willkommen in unserer Kirchengemeinde in Kreuzberg-Mitte! Was hat Dich mit deiner Familie vor einem Jahr von Freiburg nach Berlin gezogen?
Wir – mein Mann Christoph, ich und inzwischen auch unsere kleine Amelie - sind hier vor einem Jahr zwischen der Hasenheide und dem Landwehrkanal gelandet, und wir fühlen uns hier sehr wohl. Oft werden wir gefragt, was einen nach 16 Jahren aus dem grünen Freiburg im Breisgau nach Kreuzberg verschlagen hat. Für uns war es die Gelegenheit, sich mit Ende dreißig nochmal richtig neu aufzumachen und als Brandenburgerin und Sachse näher an unsere Familien zu ziehen.
Warum gerade Kreuzberg?
Kreuzberg war Zufall: Der Finger auf der Stadtkarte landete ganz einfach auf der Mitte unserer Arbeitswege. J So waren uns die Stadt und die Landschaft der stillen Reize drum herum nicht ganz unbekannt. Doch mit Berlin-Kreuzberg als Lebensraum mussten wir uns erst vertraut machen. Und klar, es sind die Kontraste, das Bunte, was wir spannend finden oder auch das andere Lebensgefühl, was einen überkommt, wenn man den Südstern oder die Schönleinstraße betritt.
Was brachte Euch in die Kirchengemeinde in Kreuzberg-Mitte?
Im Gespräch mit Freunden über die neue Beheimatung half uns der Gedanke, sich sein Dorf und seine Dorfgemeinschaft zu suchen, das direkt Umliegende. Und genau so eine Dorfstruktur haben wir mit der Melanchthon-Kirche entdeckt. Als wir in den Gottesdiensten eine wunderbare Lebendigkeit und Offenheit miterleben konnten, kam eines zum anderen. Schön war es für uns, dass Dorle und Oliver uns gleich beim ersten Kirchenkaffee ansprachen. Letzte Woche wurde dann unsere Tochter Amelie in der Melanchthon-Kirche getauft, so kommen wir alle drei langsam in der Gemeinde an.

Du hast gleich in den ersten Wochen Pastor Jean-Luc aus Kamerun in unsere Gemeinde eingeladen. In der St. Simeon-Kirche feierten wir spontan einen gemeinsamen Gottesdienst. Wie hast Du Jean-Luc kennengelernt?
Ich habe Jean-Luc eigentlich über seinen Schwiegervater Pierre Emmanuel Njock (PEN) kennen gelernt. Das war im Sommer 2009 in einer einfachen Holzkirche in Yaounde, Kamerun. Ich war gerade angekommen, um am Goethe Institut Deutsch zu unterrichten, und ich erinnere mich noch, dass alle Gesichter erst einmal gleich für mich aussahen.
Wie hast Du in Kamerun gelebt?
In diesem Sommer konnte ich bei PEN und seiner Familie afrikanisch mitleben und in die spannende Familiengeschichte und Stammesgeschichte, besonders der Basaa, eintauchen. Neben meinem Unterricht in der hupenden flachgebauten Großstadt bewegten wir uns zwischen staubigen Sandautobahnen des Urwaldes und abgelegenen Dörfern.
Was verbindet Euch heute?
Die Freundschaft zur ganzen Familie ist bis heute intensiv, und gemeinsame Projekte sind entstanden. Zwei weitere Male konnten mein Mann und ich die Familie Njock besuchen und zugleich workshops in einer abgelegenen Region halten. Ich schätze besonders die Gottestreue der Familie und den Einsatz für ihr Land.
Welchen Beitrag leistet Pastor Jean-Luc für sein Land Kamerun?
Sowohl PENs als auch Jean-Lucs Familie helfen, die afrikanischen Stammessprachen zu erhalten, zum Beispiel durch die Übersetzung der Herrnhuter Losungen ins Basaa. Trotz vieler Möglichkeiten sind PEN und Jean-Luc nach Aufenthalten in Europa - PEN war nach der Unabhängigkeit 1960/61 einer der ersten Stipendiaten in Heidelberg - wieder zurück nach Kamerun gegangen, um zu Hause etwas zu verändern. Ihr Einsatz für Witwen, Prostituierte und Waisen haben meine größte Anerkennung und Bewunderung.
Liebe Christine, danke für das Gespräch. ich wünsche Dir, Christoph und Amelie noch ein wunderbares Ankommen in Kreuzberg und in unserer Gemeinde!
Die Fragen stellte Christoph Heil

